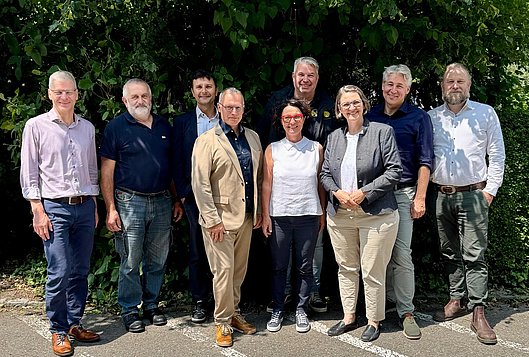50 Jahre Bronner und Solaris
Die PIWI-Sorten Bronner und Solaris feiern in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Aber wie kamen sie zustande? Und welche Vorteile bieten sie? Diese Fragen beantwortet Ernst Weinmann, Leiter der Abteilung Weinbau und Resistenzzüchtung am Weinbauinstitut Freiburg, im Interview.
Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilzkrankheiten wie Falschen und Echten Mehltau ist eines der wichtigsten Züchtungsziele im Weinbau. Deshalb begann in den 1970er-Jahren die Entwicklung von pilzwiderstandsfähigen Weinreben, sogenannten „PIWI-Sorten“, durch die Einkreuzung von amerikanischen Wildreben in europäischen Reben. Trotzdem solche Sorten, beispielsweise Bronner, Solaris, heute noch in überschaubaren Mengen angebaut werden, hat ihre Verbreitung in den letzten 50 Jahren stark zugenommen. Weil sie mehrere Vorteile bieten, und zwar für Winzerinnen und Winzer ebenso wie für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber. Ernst Weinmann, ein Experte beim Thema Resistenzzüchtung, erklärt im Interview, was PIWI-Sorten ausmacht und wieso sie eine große Zukunft haben.
Südtiroler Landwirt: Herr Weinmann, können Sie uns ein wenig über die Entstehungsgeschichte der PIWI-Sorten Bronner und Solaris erzählen?
Ernst Weinmann: Auf der Suche nach robusten Rebsorten begann Norbert Becker am Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg bereits in den 1970er-Jahren mit der Züchtung pilzwiderstandsfähiger Sorten. Zwei seiner erfolgreichsten Kreuzungen aus dem Jahr 1975 sind Bronner und Solaris. Beide gehen auf die Sorte Merzling und resistente Zuchtstämme mit Wildreben-Erbgut zurück. Bronner, benannt nach dem Weinbaupionier Johann Philipp Bronner, wurde 1999 zugelassen, Solaris folgte 2004. Heute gelten sie als Hoffnungsträger für einen umweltfreundlicheren Weinbau.
Was war damals die Motivation, pilzwiderstandsfähige Rebsorten zu entwickeln?
Zwischen 1850 und 1875 wurden drei gefährliche Schadorganismen der Rebe aus Nordamerika nach Europa eingeschleppt, die Reblaus und die beiden Pilzkrankheiten Falscher und Echter Mehltau. Da die europäischen Reben keine ausreichenden Abwehrkräfte gegen diese Schaderreger hatten, richteten die eingeschleppten Organismen verheerende Schäden im europäischen Weinbau an. Zur Gesunderhaltung der Reben mussten und müssen seitdem in regelmäßigen Abständen gezielte Fungizidbehandlungen gemacht werden. Das Wissen um die in Nordamerika beheimateten Reben, die im Zuge der Evolution Resistenzeigenschaften gegen die pilzlichen Erreger aufbauen konnten, führte zu ersten Versuchen, die europäischen Kultursorten und die amerikanischen Wildsorten miteinander zu kreuzen. Damit startete auch die Resistenzzüchtung in Freiburg in den 1950er-Jahren.
Wie lange hat es danach noch gedauert, von den ersten Kreuzungen bis zu den marktreifen Sorten?
Die beiden Sorten Bronner und Solaris wurden im Jahr 1975 gekreuzt. Bis es zur Zulassung durch das Bundessortenamt (BSA) kam, sind bei Bronner (Zulassung 1999) 24 Jahre vergangen, bei der Sorte Solaris (Zulassung 2004) sogar 29 Jahre. In den Jahren vor der Zulassung wurden viele Versuchsanbauten gemacht, woraufhin dann eine Anmeldung beim Bundessortenamt (BSA) im Jahr 1991 für Bronner bzw. 1995 für Solaris erfolgte.
Wie hat sich die Bedeutung von PIWI-Sorten wie Bronner, Solaris in den letzten 50 Jahren entwickelt?
Die Bedeutung der PIWI-Sorten hat in den letzten Jahren in Europa stark zugenommen. Aufgrund der mit Standardsorten vergleichbaren Qualität der Weine kann die Winzerin, der Winzer mit den PIWIs die Umwelt schützen und gleichzeitig den finanziellen arbeitswirtschaftlichen Aufwand in den Flächen senken. Es ist in den nächsten Jahren zu erwarten, dass die öffentliche Diskussion um die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln weiter zunimmt. Deshalb haben die Produzentinnen und Produzenten in Südtirol bereits vor Jahrzehnten reagiert und Flächen mit PIWI-Sorten bepflanzt und sehr gute Konzepte für die Vermarktung dieser PIWI-Weine entwickelt. Dabei konnte beispielsweise bei Weinen der Sorte Solaris aus Lagen über 1.000 Meter Meereshöhe oder von Bronner mit seiner vielschichtigen Eleganz das sehr hohe Potenzial der Sorten in eleganter Weise genutzt werden. Nicht vergessen darf man aber die aufgrund des Klimawandels und den dadurch sehr unterschiedlichen Wetterereignissen zunehmend schwierigere Situation im Pflanzenschutz. In dieser Hinsicht geben die PIWI-Sorten den Weinbäuerinnen und -bauern ein Plus an Sicherheit.
Haben Sie besondere Erinnerungen an die ersten erfolgreichen Versuche mit den PIWI-Sorten Bronner und Solaris?
Von der Kreuzung einer Sorte bis zur ihrer Anerkennung vergehen in der Regel 25 bis 30 Jahre. In dieser Zeit werden in weinbaulichen und önologischen Versuchen Ergebnisse gesammelt, die für den Sortenschutz und die Anerkennung einer Rebsorte notwendig sind. Zunehmend gibt es einen intensiven fachlichen Austausch mit den Winzerinnen und Winzern vor Ort. In dieser Phase hatten wir als Weinbauinstitut Freiburg einen intensiven Austausch mit Winzern in Südtirol, die maßgeblich an der Anerkennung dieser Rebsorten in den Regionen Italiens beteiligt waren. Von dieser Zusammenarbeit haben wir sehr profitiert.
Was bedeutet es für Sie persönlich, dass Bronner und Solaris heuer ihren 50. Geburtstag feiern, und was wünschen Sie sich für die Zukunft der PIWI-Sorten allgemein?
Geburtstage sind immer ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und den Blick auf das schon Erreichte zu richten. Die Entwicklung der letzten Jahre war für die PIWIs sehr gut. Wir haben hier nämlich den Schritt aus der Nische geschafft und sehen für unsere Sorten auch noch weiteres Potenzial. Das spornt natürlich auch an. In der Zukunft geht es darum, Rebsorten mit einer verbesserten Resistenz zu entwickeln, die zudem noch besser mit dem Klimawandel klarkommen.
Inwiefern können pilzwiderstandsfähige Sorten wie Bronner, Solaris einen Beitrag zum nachhaltigen Weinbau leisten und welche neuen Anforderungen stellen Klimaveränderungen heute an Rebsorten?
Pilzwiderstandsfähige Sorten wie Bronner, Solaris spielen eine entscheidende Rolle im nachhaltigen Weinbau, da sie weniger anfällig für Krankheiten wie Echten und Falschen Mehltau sind. Dies reduziert den Bedarf an chemischen Pflanzenschutzmitteln im Vergleich zu klassischen Rebsorten deutlich, was nicht nur die Umwelt schont, sondern auch die Gesundheit der Winzerinnen undWinzer sowie der Verbraucherinnen/Verbraucher schützt. Durch den Anbau solcher Sorten kann man zudem die Biodiversität fördern und den Einsatz von Ressourcen optimieren, was zu einer insgesamt nachhaltigeren Weinproduktion führt. Klimaveränderungen stellen neue Anforderungen an Rebsorten, da sich die Anbaubedingungen verändern. Höhere Temperaturen, unregelmäßige Niederschläge und extreme Wetterereignisse erfordern Rebsorten, die nicht nur resistent gegenüber Krankheiten sind, sondern auch besser mit Stressfaktoren wie Trockenheit oder Hitzewellen umgehen können. Das macht diese Sorten zu einer wertvollen Wahl für die zukünftige Weinproduktion. Insgesamt tragen pilzwiderstandsfähige Sorten dazu bei, die Weinproduktion umweltfreundlicher und resilienter gegenüber den Herausforderungen des Klimawandels zu gestalten.
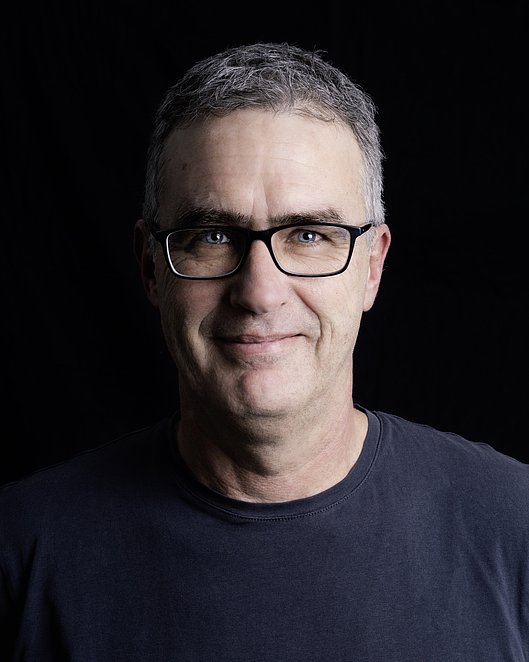
Ernst Weinmann ist Leiter der Abteilung Weinbau und Resistenzzüchtung in Freiburg.