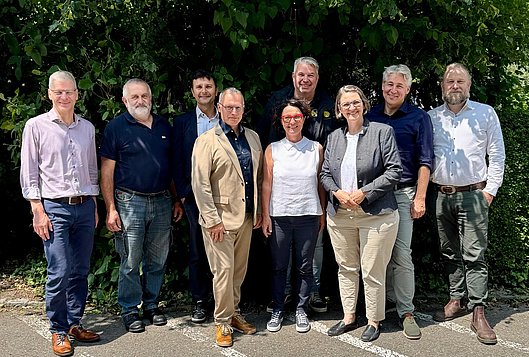Herausforderungen im Beerenanbau
Der Erd- und Himbeeranbau standen im Mittelpunkt der diesjährigen (ersten) Beerenobsttagung im Haus der Tierzucht. Sie wird von nun an alle zwei Jahre stattfinden und aktuelle Themen behandeln.
Mit einem Rückblick in die Beerenobstsaisonen 2021 und 2022 begann die diesjährige Beerenobsttagung. Berater Christof Malleier vom Beratungsring Berglandwirtschaft BRING, der die Tagung nun alle zwei Jahre (im Wechsel mit der Steinobsttagung) ausrichten wird, fasste zusammen: 2021 war geprägt von ergiebigen Schneefällen und kühlen Temperaturen im Winter, was mancherorts zu Überwinterungsschäden und einem verzögerten Vegetationsbeginn geführt hat. Durch die warmen Temperaturen im Sommer konnten die Pflanzen den Rückstand jedoch aufholen. 2022 war im Herbst und Winter hingegen trocken, Trockenschäden waren mancherorts die Folge. Durch die warme Witterung im Sommer kam es in beiden Jahren zu einem erhöhten Schädlingsaufkommen. 2021 breiteten sich beispielsweise die Spinnmilben oder die Triebspitzengallmücken rasant aus. 2022 war der Blütenstecher in Erdbeer- und Himbeeranlagen verstärkt zu beobachten. Neben chemischen Bekämpfungsmaßnahmen wurde versucht, vermehrt Nützlinge als Gegenspieler in die Anlagen einzubringen.
Thripse und Milben
Martin Keller von BASF Schweiz sprach über Maßnahmen gegen Schädlinge im Beerenanbau mit Schwerpunkt auf Thripsen und Weichhautmilben. Die insgesamt höheren Temperaturen schaffen ideale Bedingungen für die Vermehrung dieser Pflanzenschädlinge. Keller empfahl, natürliche Stoffe zur Bekämpfung von Schadorganismen zu verwenden. Ihr Vorteil ist, dass aufgrund ihrer komplexen Zusammensetzung keine bzw. weniger Resistenzen entwickelt werden. Bei synthetischen Mitteln sei eine gezielte Anwendung zu beachten und einer Resistenzbildung durch fachgerechte Applikation entgegenzuwirken. Vor allem sei es wichtig, natürliche Gegenspieler zu fördern, zum Beispiel Raubmilben und -wanzen. Sie ernähren sich von saugenden Schadinsekten, benötigen jedoch auch Pollen und Nektar. Um ihren Bestand zu sichern, muss deshalb das Pollen- und Nektarangebot in der Obstbaufläche gesichert werden. Im Falle der Raubwanze habe sich laut Keller eine gräserreiche Einsaat bewährt, da sich der Nützling überwiegend von Gräserpollen ernährt.
Richtige Entscheidungen zu Kulturbeginn
Der Erfolg der Südtiroler Erdbeererzeugung basiert auf der ausgezeichneten Fruchtqualität, die dank der besonderen Boden- und Klimabedingungen sowie der Anwendung geeigneter Anbautechniken erreicht wird, erklärte Sebastian Soppelsa vom Versuchszentrum Laimburg. Insbesondere Entscheidungen vor dem Pflanzzeitpunkt hätten einen großen Einfluss auf die qualitativen Eigenschaften und die Produktivität der Erdbeere. Darüber hinaus spielen Pflanzzeitpunkt, Pflanzmaterial, Sortenwahl und Pflanzdichte eine zentrale Rolle.
Himbeeren – Praxis und Züchtung
In San Giovanni Lupatoto bewirtschaftet Alessandro Lucchini gemeinsam mit seiner Frau einen im Jahr 2000 gegründeten landwirtschaftlichen Betrieb. Er umfasst 2,6 Hektar Himbeeranbau und weitere Flächen mit verschiedenem Beerenobst. Zudem befindet sich ein großes Gewächshaus zur Pflanzenanzucht auf dem Betriebsgelände. Heidelbeeren wie Himbeeren werden nicht in den Boden, sondern in Töpfe gepflanzt. Der gesamte Himbeeranbau findet in Tunnels statt. In den 22 Betriebsjahren wurden verschiedene Himbeersorten aus aller Welt angebaut und getestet. Diese Tests waren und sind nicht nur für den Betrieb, sondern auch für die Pflanzenzüchter wertvoll. Um die eigene Produktion zu erleichtern und zu verbessern, wurden neue Himbeersorten gezüchtet. Hauptaugenmerk wurde dabei nicht auf den Ertrag, sondern auf die Arbeits- und Anbauerleichterung gelegt, weshalb diese Sorte den Namen „Easy“ erhalten hat. In der Schädlingsbekämpfung setzt man nahezu ausschließlich auf natürliche Bekämpfungsmethoden. Große Probleme bereitet die Marmorierte Baumwanze, weswegen an der Grundstücksgrenze Fallen angebracht sind, um das Einwandern des Schädlings zu verhindern.
Den ganzen Bericht finden Sie ab Freitag in der Ausgabe 3 des „Südtiroler Landwirt“ vom 17. Februar ab Seite 47, online auf „meinSBB“ oder in der „Südtiroler Landwirt“-App.