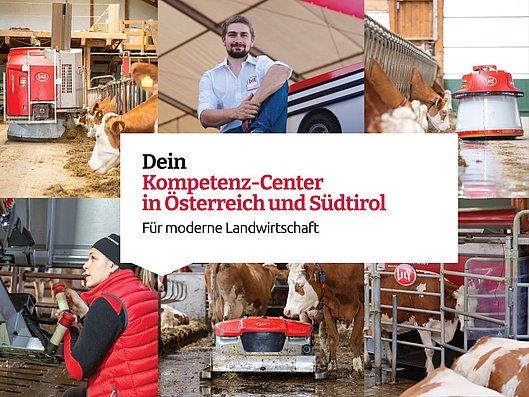Kampf gegen den Borkenkäfer
Ein Blick in die Wälder zeigt vielerorts in diesem Sommer ein verheerendes Bild: Ganze Berghänge sind voller offensichtlich kranker Bäume, unter den Waldbesitzern macht sich Resignation breit. Eine Bestandsaufnahme.
Der „Hauptschuldige“ für dieses verheerende Bild ist bekannt: Die „fliegenden Buchdrucker“ gehören zur Familie der Borkenkäfer und sind – für alle sichtbar – in großen Mengen in Südtirols Wäldern zu Hause. Das Insekt bohrt Gänge unter die Rinde und unterbricht damit den Saftfluss der Bäume, was zu deren Absterben führt. Befallen werden in der Regel frische, liegende Bäume oder abgeschwächte stehende Fichten. Gesunde Bäume können sich gegen den Befall durch die Bildung von Harz erfolgreich wehren.
Wie es zur aktuellen Massenvermehrung kam
Wie konnte es so weit kommen? Und hätte man etwas tun können, um die jetzige Situation zu verhindern? Die Antwort auf die erste Frage ist ebenfalls bekannt – dennoch soll ein Exkurs noch einmal klären, wie eine solche Massenvermehrung möglich war.
Der Blick geht zurück in die letzten Oktobertage des Jahres 2018: Nach dem Sturm Vaia hatte der Käfer die Möglichkeit – trotz der fleißigen und schnellen Räumungsarbeiten – viel liegendes Holz zu besiedeln und sich somit numerisch gut zu etablieren. Dabei wurden nur liegende Bäume befallen, die keinen Widerstand leisten konnten.
Schneedruck-Holz war für den Käfer gute Brutstätte
Einen zweiten Meilenstein der Entwicklung bildete das Schneedruckereignis im November 2019, das in ganz Südtirol eine bedeutende Schadholzmenge in Form von Streuschäden verursachte. Dieses Holz blieb aufgrund der erhöhten Schwierigkeiten im oft unwegsamen Gelände und wegen der Unwirtschaftlichkeit der Holzbringungsarbeiten länger liegen. Davon konnte der Borkenkäfer gut profitieren. Die für den Käfer ungünstige Witterung im Sommer 2020 verhinderte dann vorerst dessen starke Vermehrung, weshalb sich die Schäden in Grenzen hielten. Befallen wurden in der Regel nur liegende Bäume. In der Tat war die Massenvermehrung damals bereits im Gange, allerdings im Verborgenen.
Ideales „Borkenkäferwetter“
So wurden die Voraussetzungen für den Stehendholzbefall geschaffen, der sich im Sommer 2021 ereignete: Nach einem kühlen Frühjahr gab es ab Anfang Juni eine plötzliche Wärmewelle, woraufhin die überwinterten Käfer massenhaft und alle auf einmal zum Flug ansetzten. Da die liegenden Stämme nicht mehr bruttauglich waren, wurden die stehenden Bäume befallen. Besonders auffällig war das Phänomen genau dort, wo nach den Schneedruckereignissen von 2019 und 2020 viel Holz liegen geblieben war. Andernorts waren die Käfernester geringerer Ausdehnung und im Wald verstreut.
Überwintert hat der Buchdrucker dann als Adultkäfer unter der Rinde, in kleinerem Ausmaß in der Bodenstreu. Die Spuren der fleißigen Arbeit des Spechtes – ein natürlicher Gegenspieler des Borkenkäfers – sind oft heute noch sichtbar: Die Sterberate bei den Käfern ist dadurch sicherlich, der relativ milde Winter 2021/22 hat aber als Eindämmungsfaktor für den Käfer sicher keine große Rolle gespielt.
Massenflug in diesem Frühjahr
Die überwinterten Adultkäfer flogen gegen Mitte Mai des laufenden Jahres alle auf einmal, weil Temperatur und Feuchtigkeit für sie ideal waren. Die Lockstofffallen des Monitoringnetzes der Landesabteilung Forstwirtschaft sammelten in mehreren Orten über 20.000 Individuen in nur zehn Tagen. Der weitere Witterungsverlauf des Sommers 2022 ist bekannt – unglücklicherweise war er für den Borkenkäfer günstig: Besonders die Hitzewelle im Juli war ideal für den Flug der aus der Eiablage von Mai entstandenen Jungkäfer und brachte zugleich oft die Wirtsbäume in eine ungünstige Trockenstresssituation.
So breitete sich der Käfer, ausgehend von den ohnehin schon stark befallenen Gebieten wie dem Gadertal, Pragser und Antholzer Tal weiter aus. Käfernester tauchten auch in Gebieten auf, die bis dato verschont geblieben waren. Ein Teil der Adultkäfer ließ sich auf der Suche nach neu zu besiedelnden Gebieten von Luftströmungen und Wind treiben – leider allzu oft mit Erfolg.
Waldbesitzer stellen sich viele Fragen
Viele Waldbesitzer stellen sich nun berechtigterweise Fragen über die Zukunft: Wie lang wird der Befall noch dauern? Wie sollen sie nun darauf reagieren? Nun, wir haben gelernt, mit Vorhersagen vorsichtig umzugehen. Wenn wir aber bei bekannten, soliden Daten bleiben, lässt sich ein Trend daraus ablesen. Als Indikator nehmen wir den Jahresdurchschnittswert der Fangwerte aller Lockstofffallen im Land (siehe Grafik auf S. 37).
Wie man sieht, sind die Zahlen exponentiell gestiegen. Je nach Witterungsverlauf im kommenden Jahr kann sich der Befall verlangsamen oder weiter steigen. Sicher ist: Jede Massenvermehrung hat einen Anfang (der in diesem Fall vorbei ist, das kann man mit Sicherheit sagen), eine akute Phase und ein Ende. An welchem Punkt dieser Entwicklung wir heute stehen, kann man nur nachträglich sagen. Deswegen sind jetzt Geduld und rationelles Denken notwendig – so schwer das beim herzzerreißenden Blick in die Wälder auch fallen mag.
Die Versuchung, alles zu räumen, ist da – genauso wie jene, am gesunden Bestand zu arbeiten, als ob es eine entzündete Wunde wäre. Leider ist schon seit Langem bekannt, dass dies nicht funktioniert. Das haben Daten aus der Vergangenheit mehrmals gezeigt. Wie intensiv man dem Borkenkäfer auch nachläuft, er ist schneller. Sinnvoller ist es daher, je nach Situation zu begutachten, ob und in welcher Form es ratsam ist, die Käferbäume zu entfernen. Besonders wenn sie am Rande einer Freifläche stehen, ist es sinnvoll, sie stehen zu lassen, weil sie die dahinterstehenden, noch gesunden Bäume schützen.
Den ganzen Bericht finden Sie ab Freitag in der Ausgabe 16 des „Südtiroler Landwirt“ vom 16. September ab Seite 36, online auf „meinSBB“ oder in der „Südtiroler Landwirt“-App.