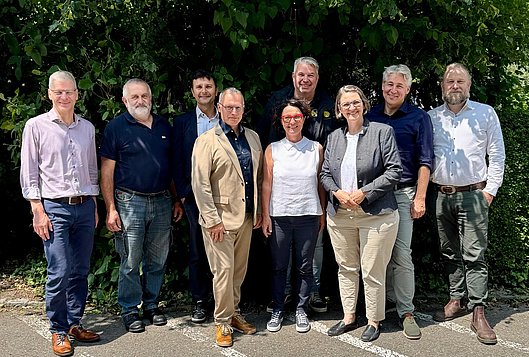Weinwirtschaft: ein Platz an der Sonne
Während die globale (Wein-)Wirtschaft durch eine Reihe von Krisen Gewitterwolken aufziehen sieht, liegt Südtirols Weinwelt (noch) in der Sonne, bestätigten die Referenten der Weinbautagung. Sie sprachen aber vor allem darüber, was zu tun ist, damit es so bleibt.
Zur Eröffnung der diesjährigen 62. Weinbautagung gab es viel Lob für die Südtiroler Weinbäuerinnen und Weinbauern. Landeshauptmann Arno Kompatscher war zu diesem Anlass in den Raiffeisensaal nach Eppan gekommen. Solange die neue Landesregierung noch nicht im Amt ist, ist er nämlich auch Landesrat für Landwirtschaft: „Ich bin stolz auf das große Netzwerk in der Weinwirtschaft, die von der Forschung über die Aus- und Weiterbildung und die Beratung bis hin in die vielen großen und kleinen Kellereien reicht. Besonders stolz bin ich aber auf euch Weinbäuerinnen und Weinbauern im Land, die ihr mit Hingabe und Fleiß arbeitet und so den Grundstein legt für die hohe Weinqualität, für die unser Land inzwischen praktisch weltweit bekannt ist.“
Angespannte Situation am Weltweinmarkt
Dass man sich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen darf und sich bereits jetzt für die Herausforderungen der Zukunft rüsten muss, wurde im Laufe des Vormittags deutlich. Stefan Pircher, Obmann des Vereins Landwirtschaftlicher Schulen (A. L. S), erklärte in seiner Eröffnungsrede auch: „Das Jahr 2023 war insgesamt ein gutes Jahr für den Weinbau. So liegen nun ansprechende Weine in den Kellern, die zu guten Preisen abgesetzt werden können.“ Am Weltmarkt sehe die Situation aber weniger entspannt aus: Ein allgemeiner Konsumrückgang führe teils zu starkem Preisdruck bei den Weinen. Entsprechend besorgt blicke man in die Zukunft, die durch Herausforderungen wie weltweite Konflikte, internationale Handelskriege, Kostensteigerungen oder Klimawandel nicht besonders rosig aussehe.
Weinbauflächen global rückläufig, Erntemenge in etwa konstant
Hansjörg Hafner vom Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau sprach zunächst über Entwicklungen im Weinbau und in der Weinwirtschaft und stellte sich der Frage „Gibt es eine neue Weltweinrealität?“. Zunächst ging er auf die derzeitigen großen Herausforderungen ein, die der Weinwirtschaft international Kummer bereiten: Aus dem Businessreport, der alljährlich zur Messe ProWein veröffentlicht wird, geht hervor, dass vor allem die allgemeine Kostensteigerung und der Wirtschaftsabschwung Sorgen bereiten, gefolgt von Tendenzen wie dem rückläufigen Weinkonsum, einer geringeren Rentabilität, dem Klimawandel und dem Personalmangel, den zunehmenden Umweltauflagen, der Unterbrechung von Lieferketten, dem internationalen Handelskrieg und den Auswirkungen einer weinfeindlichen Gesundheitspolitik.
Dann ging Hafner auf den internationalen Weinmarkt ein: Insgesamt werden weltweit 708 Millionen Dezitonnen Trauben geerntet, nur ein Teil davon wird zu Wein weiterverarbeitet. Während die Anbauflächen insgesamt rückläufig sind (im Jahr 2022 waren es 300.000 Hektar weniger als noch 2020), steigen sie in Europa leicht an: 3,3 Millionen Hektar Weinbaufläche gibt es aktuell in der Europäischen Union.
Trotzdem die Flächen sinken, ist die globale Erntemenge in etwa dieselbe geblieben. Dem gegenüber steht ein sinkender Weinkonsum. Dafür gibt es laut Hafner verschiedene Gründe: Am stärksten ins Gewicht fallen die sinkenden Haushaltsbudgets und der allgemeine Trend hin zu günstigeren Weinen, aber auch die Verlagerung hin zu anderen Getränkekategorien ist für den rückläufigen Weinkonsum verantwortlich.
Südtirol trotzt Klimawandel erfolgreich
Weltweit werden die Auswirkungen des Klimawandels immer stärker spürbar. Auch in Südtirol kann ein durchschnittlicher Temperaturanstieg von zwei Grad festgestellt werden. Das erhöht, gemeinsam mit dem Auftreten von neuen Schadorganismen wie der Amerikanischen Rebzikade (Überträger der Goldgelben Vergilbung) oder – ganz aktuelle – der Wolllaus Planococcus ficus den Druck auf die Winzerinnen und Winzer. Trotzdem hat es die Südtiroler Weinwirtschaft durch agronomische Maßnahmen und technische Anpassungen bisher geschafft, den Folgen des Klimawandels zu trotzen und ist deshalb bislang nicht stärker davon beeinträchtigt worden, wie Hafner feststellte. „Neuanlagen gehen Schritt für Schritt in höhere Lagen, auch schon über 1000 Meter Meereshöhe gibt es in Südtirol inzwischen Rebflächen. Hansjörg Hafner unterstrich, dass es eine der Stärken des Südtiroler Weinbaus sei, sich an Veränderungen anpassen zu können, wie sich gerade beim Thema Klimawandel deutlich zeige. Diese Bereitschaft sei mit ein Grund für den bisherigen Erfolg und könne auch die Zukunft Südtirols sichern.
Echte Nachhaltigkeit und kein Greenwashing
Dasselbe gelte für das Thema Nachhaltigkeit: „Auch wenn man das Wort kaum noch hören kann, weil es vergriffen ist, so müssen wir uns mit Themen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen, wobei neben der ökologischen auch ökonomische und soziale Aspekte mit berücksichtigt werden müssen.“ Hafner plädierte für echte Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Was die ökologische Nachhaltigkeit anlange, brauche es Maßnahmen, die wirklich ressourcen- und umweltschonend sind, und kein Greenwashing. Besonderes Augenmerk gelte hier natürlich der Glasflasche, die beim CO2-Fußabdruck der Weinwirtschaft stark ins Gewicht falle.
30 Jahre Erfolgsgeschichte
Dass qualitativ hochwertige Weine nur in der Glasflasche und mit Korken ihren Wert unterstreichen können, davon zeigte sich Klaus Gasser überzeugt. Der Marketing- und Verkaufsdirektor der Kellerei Terlan hatte für seinen anschließenden Beitrag den Titel „Wo Sonne ist, ist auch Schatten“ gewählt und wagte Rück- und Ausblick auf die Südtiroler Weinvermarktung, die er seit 30 Jahren mitverfolgt und auch mitgeprägt hat. 1994 hat Gasser in der Kellerei Terlan zu arbeiten angefangen. Damals lieferte die Kellereigenossenschaft 80 Prozent der Weine als Literware, 80 Prozent des Produktionsvolumens wurden in Südtirol abgesetzt. Die Preise waren unter Druck, die Erlöse für die Weinbauern niedrig. Einige Vorreiter wagten sich dann auf Neuland und begannen unbeirrt, Qualitätsweine zu produzieren. Die italienischen Weinführer honorierten diese Qualitätsbestrebungen, ihnen sei es laut Gasser auch zu verdanken, dass man mit den Jahren begann, die Weißweine aus Südtirol zu schätzen – zunächst auf nationaler, später dann auch internationaler Ebene.
Rebsorten mit guten Renditen setzten sich durch
Im Laufe der Zeit hat sich auch der Sortenspiegel im Land verändert: Vom Vernatsch-Land sei man zum Weißweinland mit internationalem Renommee geworden. So setzten sich Rebsorten mit guten Renditen durch. Klaus Gasser meinte: „Der Vernatsch wird zwar nach wie vor gerne getrunken, aber er bringt in der Regel wenig Verdienst.“ Deshalb plädiere er dafür, nur Vernatsch im gehobenen Qualitätssegment zu produzieren, damit man damit auch gut Geld verdienen könne.
Weißweintrend für Südtirol positiv
Insgesamt gehe die Tendenz hin zu Weißweinen. Das sei für Südtirol eine gute Entwicklung, meinte Gasser. Wie die vor etwa 20 Jahren, als man sich von den extrem konzentriert strukturierten Weine (sogenannte „Parker-Weine“) abwandte und sich wieder für elegante, feine Rotweine zu interessieren begann. Damals sei auch der Pinot noir wieder in Mode gekommen, was der Südtiroler Weinstilistik sehr zugutekam. Gasser gab einen kurzen Überblick über die großen Krisen der letzten 30 Jahre: von Kriegen, dem Fall der Twin Towers über Rohstoffverknappung und Energiekrise bis hin zur Corona-Krise, die die Südtiroler Weinwelt über Nacht praktisch lahmgelegt habe. „Corona hat uns gezeigt, wie anfällig Märkte sind“, sagte Gasser. Deshalb müsse man sich frühzeitig darüber Gedanken machen, wie man „auf der Sonnenseite bleibt“.
Wer alles kann, kann nichts
Es gelte also, sich als Weinwirtschaft für die Zukunft zu rüsten: Das bedeutet für Gasser konkret, dass man sich in der Vermarktung breit aufstellen, die Märkte differenzieren müsse, um resilient zu sein gegenüber Krisen. Dass Südtirol sein Sortenprofil in der Kommunikation schärfen sollte: „Wer alles kann, kann nichts“, mahne er, sprach sich aber auch dafür aus, die Sortenvielfalt im Anbau aufrechtzuerhalten. Gasser forderte auch, dass die Marke Südtirol international gestärkt werden müsse, um sie kontinuierlich nach vorne zu bringen. Und nicht zuletzt, dass der Export auf 40 bis 50 Prozent gehoben werden müsse.
Plädoyer für Glyphosat-Verzicht
Die Bedeutung echter Nachhaltigkeit, unterstrich auch Klaus Gasser: Sie dürfe kein Lippenbekenntnis bleiben, man müsse echte Nachhaltigkeit leben. „Ein Verzicht auf Glyphosat wäre in der Kommunikation mit Kunden und Journalisten ein echtes Plus, das müssen wir schaffen, zumal die Zulassung sowieso irgendwann fallen wird“, meinte Gasser und schloss mit den Worten: „Das beste Marketing sind große Weine, also international bekannte Weine!“ Und die könne man erreichen, indem im Weinberg hart gearbeitet werde und die Qualität, die man dort zu erreichen imstande ist, durch starke Techniker im Weinkeller in die Flasche bringt.
Automatisierung, KI, Pflanzenschutz und neue Klone
Matthias Porten vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel sprach über Automatisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und wie diese Entwicklungen den Weinbau verändern werden. Er zeigte den Bäuerinnen und Bauern im Saal, wie die Zukunft angesichts der Herausforderungen wie Personalmangel oder Klimawandel im Weinberg in nicht allzu weiter Zukunft aussehen wird: von der vollautomatischen optischen Traubensortierung über den Einsatz von Drohnen und dem Einsatz autonom fahrender Geräte, die mit Aufsätzen für Laubarbeiten, Pflanzenschutzapplikationen und auch Ernte kombiniert werden können. Er erklärte die Vorteile dieser Vollautomatisierung und die Integration der künstlichen Intelligenz für eine künftig weiterhin profitable Weinwirtschaft.
Dirk Hübner von 2farm GmbH aus Ockersheim zeigte, wie man mit künstlicher Intelligenz im Rebschnitt arbeiten kann. In einem dreijährigen Projekt sei eine App entwickelt worden, derzeit noch ein Prototyp. Über das Smartphone könne der Rebstock visuell erfasst werden, die App schlägt dann die möglichen Schnittstellen vor. So könne auch ungeschultes Personal die Reben richtig schneiden, was Kosten spare.
Der Nachmittag der Weinbautagung stand im Zeichen der Praxis: So referierte Josef Terleth vom Versuchszentrum Laimburg über Klone und Selektionen im Vergleich am Beispiel der Sorte Blauburgunder, Urban Spitaler vom Versuchszentrum Laimburg über zukünftige Bausteine einer resilienten Pflanzenschutzstrategie und Florian Sinn vom Beratungsring für Obst- und Weinbau erzählte über gewonnene Erkenntnisse in der Rebchirurgie.