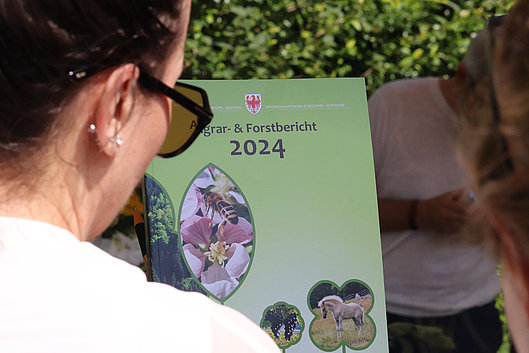Berglandwirtschaft hat viele Chancen
Professor Matthias Gauly kehrt der Freien Universität Bozen (vorerst) den Rücken und reist nach Wien. Im Interview mit dem „Südtiroler Landwirt“ blickte er auf die letzten zehn Jahre zurück. Und zeigte auf, wo es in Südtirols Berglandwirtschaft noch Handlungsbedarf gibt.
Matthias Gauly hat an den Universitäten Bonn und Gießen Agrarwissenschaften mit Vertiefung Nutztierwissenschaften sowie Veterinärmedizin studiert. Er promovierte in beiden Disziplinen. Zwischen 1998 und 2003 war er Assistenzprofessor am Institut für Tierzucht und Genetik an der Universität Gießen. Danach wechselte er zum Department für Tierwissenschaften an die Universität Göttingen, wo er bis 2014 den Lehrstuhl für Produktionssysteme der Nutztiere innehatte. Ab 2014 arbeitete er an der Freien Universität Bozen: Er ist Vorsitzender der tierwissenschaftlichen Arbeitsgruppe an der Fakultät für Wissenschaft und Technologie und ab 2017 Prodekan für Forschung an der neu gegründeten Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, deren Aufbau er mitgestaltet hatte. Nun wechselt Gauly nach Wien, wo er zum neuen Rektor der Veterinärmedizinischen Universität gewählt wurde. Am 15. April ist sein Arbeitseintritt. Zum Abschied gab der dem „Südtiroler Landwirt“ ein Interview.
Südtiroler Landwirt: Herr Gauly, Sie waren gut zehn Jahre lang an der Freien Universität Bozen tätig, und haben dort die Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften mit aufgebaut. Wie schwer bzw. leicht fällt Ihnen der Abschied von der Universität? Und von Südtirol?
Matthias Gauly: Es ist ja kein Abschied im Sinne von: Ich komme nicht wieder zurück. Ich werde enge Verbindungen zu Südtirol halten. Zum einen behalte ich meine Wohnung in Lajen und werde voraussichtlich einmal im Monat in Südtirol sein. Und zum anderen gibt es eine ganze Menge an Verbindungen der Veterinärmedizinischen Universität Wien mit Südtirol: So haben wir ein Kompetenzzentrum Wiederkäuer in Innsbruck, das potenzielle Studierende der Veterinärmedizin aus Südtirol ausbildet. Übrigens mit großer Unterstützung durch den Südtiroler Bauernbund. Also, es gibt eine enge Verbindung, und die wollen wir auch noch ausbauen. Insofern ist es kein Abschied für immer und auch kein totaler Schnitt. Aber natürlich ein Einschnitt, das ist ganz klar. Der Abschied fällt mir einerseits schwer, weil mir die Arbeit mit den Bäuerinnen und Bauern, mit den Verbänden und Genossenschaften viel Spaß gemacht hat. Das war von Anfang an spannend. Trotzdem ich von außen kam, habe ich hier gleich gut Gehör gefunden. Es ist zwar nicht alles umgesetzt worden, aber man hat mir zugehört, hat konstruktiv diskutiert. Ich glaube, das eine oder andere ist auch in Bewegung gekommen. Der Abschied von der Uni fällt natürlich auch nicht leicht, vor allem wegen der Kolleginnen und Kollegen, zu denen ich in den zehn Jahren persönliche Verbindungen aufgebaut habe. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön und spannend, noch mal eine Chance und eine neue Aufgabe zu bekommen.
An der Universität hat sich in diesen zehn Jahren viel bewegt und weiterentwickelt. Was waren für Sie die größten Meilensteine?
An der Universität auf jeden Fall die Aufsplittung der Fakultät für Wissenschaft und Technologie und die Gründung der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften vor ein paar Jahren. Nun muss sie sich konsolidieren, das braucht noch. Ich hoffe aber, dass sie sich weiterhin gut entwickelt: Es ist allerdings relativ schwierig, aus dem deutschsprachigen Raum Kollegen zu bekommen, weil wir vor allem aufgrund des Gehalts und der sozialen Rahmenbedingungen nicht unbedingt wettbewerbsfähig sind. Ich bin aber überzeugt, dass es wichtig ist, verschiedene Stellen mit einer bzw. einem Deutschsprachigen zu besetzen. Es gibt zwar auch sehr gute Kollegen aus dem italienischsprachigen Raum, aber durch die Sprache ist es für sie sehr schwierig, eine Verbindung mit der Basis aufzubauen, also mit Bergbäuerinnen und Bergbauern. Hier den geeigneten Menschen zu finden, wird die Herausforderung sein. Meilensteine gab es aber auch in der Tätigkeit draußen, in Kontakt mit den Genossenschaften, mit den Bäuerinnen und Bauern. Ich glaube, es ist uns in dieser Zeit gut gelungen, neue Denkansätze einzubringen und die Wirtschaftlichkeit der Betriebe stärker zu hinterfragen bzw. die Landwirtinnen und Landwirte dazu anzuhalten, selbst über wirtschaftliche Fragen nachzudenken: Was kostet mir der Liter Milch in der Erzeugung? Was bekomme ich dafür und wie kann ich das optimieren? Auch die Tierschutzfrage ist in dieser Zeit stark aufgekommen und wir haben sie teilweise vorweggenommen. Denn wir haben schon vor ClassyFarm daran gearbeitet, haben in Zusammenarbeit mit dem Sennereiverband ein Schulungsprojekt gemacht und waren darum früh am Start, was ClassyFarm angeht, viel früher als andere. Und wir haben sehr früh den Gedanken der Fleischerzeugung eingebracht, der zwar schon immer da war, aber nicht konkret durchdacht wurde. Da sind wir allerdings nicht so weit gekommen, wie wir das erhofft hatten, da gibt es also noch viel zu tun …
Als wie wichtig stufen Sie die Freie Universität Bozen in Forschung und Lehre für Südtirols Landwirtschaft ein?
Ich bin überzeugt, dass die Freie Universität Bozen eine wichtige Einrichtung ist, und sie ist auch alternativlos. Auch wenn sie natürlich teuer ist, das wird ja immer wieder bemängelt. Aber sie bietet die Möglichkeit, junge Leute vor Ort auszubilden. Wir können das ja nicht einfach delegieren und sie nach Österreich oder Italien zur Ausbildung schicken, sondern haben selbst auch eine Verpflichtung. Und die zweite wichtige Aufgabe ist, Forschung im Land zu haben. Ich glaube, das ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Denn das bringt die Landwirtschaft Stück für Stück voran. Allerdings muss man selbstkritisch dazu sagen: Die Bäuerinnen und Bauern draußen bekommen oft gar nicht mit, was wir hier an Innovation erforschen. Daran, glaube ich, müssen wir noch arbeiten. Wie auch an der Zusammenarbeit zwischen den Forschungseinrichtungen im Land, also Universität, Eurac und Versuchszentrum Laimburg. Da lassen wir ein bisschen Geld liegen, weil wir (noch) nicht so gut abgestimmt sind. Aber auch daran wird gearbeitet.
Sie haben Südtirols Land und Leute – vor allem die Viehhalterinnen und Viehhalter – in dieser Zeit gut kennengelernt, waren viel draußen auf den Betrieben. Was zeichnet Südtirols Bergbäuerinnen und -bauern Ihrer Meinung nach aus?
Zum einen eine starke Verbundenheit zu ihrer Tätigkeit, zum Boden, zur „Scholle“ und damit einhergehend ein starkes Verantwortungsgefühl. Das ist sehr positiv. Ein weiterer großer Pluspunkt: Bauern sind ehrlich und offen und man kann – das mag draußen in der Gesellschaft oft zwar anders rüberkommen – gut mit ihnen diskutieren, und sie lassen mit sich reden. Warum kommt das in der Gesellschaft manchmal anders an? Weil die Landwirte oft in die Enge getrieben werden. Nehmen wir zum Beispiel das aktuelle Thema der Gülleausbringung in Natura-2000-Gebieten, da steht der Landwirt sehr schnell in einer Umweltzerstörer-Ecke und am Pranger. Und immer, wenn so etwas passiert, wird’s schwierig. Deshalb muss man ihnen die Chance geben, aus dieser Ecke rauszukommen, dann kann man auch vernünftig über alles reden. Was Landwirte insgesamt aber noch nicht gelernt haben, ist, zu akzeptieren, dass das Land, das sie bewirtschaften, das ihnen ja auch gehört, trotzdem ein gutes Stück Allgemeingut ist, also allen gehört. Natur gehört jedem, Umwelt gehört jedem. Und ich denke, es würde allen Bäuerinnen und Bauern gut tun, das einfach mal zu akzeptieren und zu sagen: „Ja, das ist zwar meins, aber es gibt klare Regeln, weil ich ein Gut bewirtschafte, das der liebe Gott mir gegeben hat und an dem auch die Gesellschaft teilhaben will.“ In Südtirol ist das noch mal doppelt problematisch, weil das Land tatsächlich stark von anderen genutzt wird: von Touristen und auch Einheimischen, die wandern, mountainbiken und so. Da bräuchte es natürlich auch ein bisschen Rücksicht und Respekt im Umgang. Das heißt, die Leute müssen verstehen, dass sie über eine Weide, über Futter laufen oder radeln. Es braucht also gegenseitiges Verständnis, das muss aber noch ein bisschen wachsen – auf beiden Seiten.
Was sind Ihrer Meinung nach die großen Herausforderungen, die auf die heimische Berglandwirtschaft zukommen? Und wie, glauben Sie, kann man diesen Herausforderungen begegnen?
Das Wichtigste zuerst: Die Berglandwirtschaft hat Chancen, sie hat sogar viele Chancen. Und es gibt viele junge Leute, die Spaß haben an der Berglandwirtschaft, das sieht man bei der Bauernjugend, bei den Tierschauen überall im Land, da wimmelt es nur so vor jungen Leuten. Also gibt es eigentlich keine Nachwuchsprobleme in der Berglandwirtschaft. Aber man muss den Jungen die Möglichkeit geben, zu wirtschaften und vom Hof zu leben. Deshalb müssen wir uns darüber Gedanken machen, wo wir mit der Berglandwirtschaft hinwollen – und dafür gezielte Förderungen einsetzen, um in diese Richtung zu lenken. Nehmen wir zum Beispiel das Thema flächenabhängige Erzeugung: Wenn man Obergrenzen setzt, muss das einhergehen mit der Frage, wie die Betriebe davon leben können. Und dann kommen sehr schnell die Genossenschaften mit ins Spiel, die Vermarktungswege, der Tourismus. Was es braucht, ist also ein Gesamtkonzept, an dem alle beteiligt sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, dass uns die Berglandwirtschaft wegen der Offenhaltung der Flächen, wegen des Tourismus etc. wichtig ist, dann müssen aber auch alle mit ins Boot genommen werden. Also alle, die davon profitieren. Auch die Gesellschaft übrigens, weil wir als Südtiroler ja auch schätzen, dass wir durch offene Landschaften gehen, wandern und Ski fahren können. Potenzial haben wir in der Erzeugung von Produkten, z. B. von Fleisch, da importieren wir sehr viel. Das wäre doch ein schönes Konzept: Wir müssten weniger Tiertransporte machen, könnten unsere eigenen Kälber ausmästen. Auch da müsste der Tourismus mit ins Boot, auch da müssten andere Preise bezahlt werden.
Eine weitere wichtige Baustelle für die Berglandwirtschaft wird natürlich ihre Umweltverträglichkeit und der große Bereich Tierschutz. Auch dieses Thema wird uns nicht erspart bleiben, auch dazu müssen wir uns Gedanken machen. Also, kurz: Die Herausforderungen sind gewaltig, neben den ökonomischen sind es auch die ökologischen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können. Es ist zwar noch ein langer Weg, aber wir sind schon lange auf dem Weg. Und mit diesem Wir meine ich uns alle: Weil jede und jeder von uns tagtäglich mehrfach Kaufentscheidungen trifft. Jede dieser Kaufentscheidung greift ganz tief in die Entwicklung der Landwirtschaft ein, das muss uns bewusst sein. So einfach ist das. Wir geben ja nur etwa elf bis zwölf Prozent unseres Geldes für Lebensmittel aus. Ein bisschen mehr tut uns vielleicht weniger weh, als an einer anderen Stelle einzusparen. Es gibt in Südtirol viele Menschen, für die der Euro nicht zählt, und die können ruhig mal einen Euro mehr ausgeben, wenn ihnen die Landwirtschaft etwas wert ist.
Sie ziehen nun nach Wien, werden Rektor der Veterinärmedizinischen Universität. Dem ist ein langes Auswahlverfahren vorausgegangen. War Südtirol ein gutes Sprungbrett dafür?
Ich denke, es war eher das Gesamtpaket: Ich habe viele Jahre Berufserfahrung hinter mir, einiges an Auslandserfahrung. Wie genau ausgesucht wurde, weiß ich ja nicht. Aber für mich wird die neue Aufgabe vielleicht leichter, weil ich die Südtiroler ein bisschen kennengelernt habe und damit, glaube ich, den Österreichern auch ein bisschen nähergekommen bin. Und das Netzwerk, das ich jetzt nach Südtirol und nach Nordtirol habe, ist auf jeden Fall ein Vorteil.
Mit welchen Gefühlen gehen Sie in diese neue Aufgabe?
Mit gemischten Gefühlen: Zum einen sind die Schuhe ziemlich groß, die meine Vorgängerin hinterlassen hat, und es ist einfach eine ganz andere Aufgabe, die mich jetzt in Wien erwartet. Da gilt es, sehr viel Verwaltungstätigkeit abzuwickeln, was ich erst lernen muss. Das alles flößt mir schon Respekt ein, aber das muss wohl auch so sein. Ich habe sehr gute Vizerektorinnen gefunden, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insgesamt sind es 1500, davon 90 Professoren, also ein spannendes Umfeld. Ich freue mich also auch auf die neue Aufgabe, trotz einiger Wehmut, hier wegzugehen, das ist ganz klar.
Sie haben es schon angedeutet, ganz gehen Sie uns ja nicht verloren. Wie bleiben wir in Verbindung?
Ich bin nicht ganz weg: Mein Auftrag in Wien ist auf vier Jahre befristet, mit Option auf Verlängerung. Zunächst bin ich von der Uni Bozen beurlaubt. Trotzdem wird für den Bereich Tier eine Professur ausgeschrieben, damit der Platz nicht unbesetzt bleibt. Und ansonsten gibt es Projekte, die gemeinsam mit Nord- und Südtirol umgesetzt werden. Beispielsweise die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an der VetMed in Wien, die in Innsbruck angeboten wird. Das möchten wir noch ausbauen, die Uni in Bozen mit einbeziehen und eine Art Kompetenzzentrum Berglandwirtschaft aufziehen.