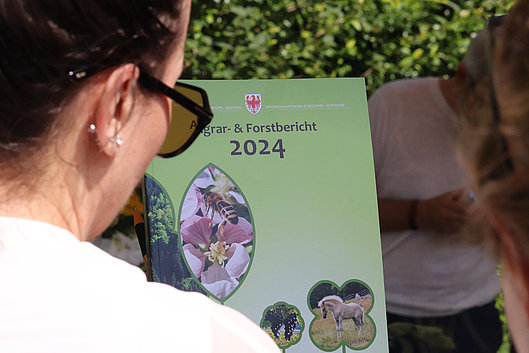Forschung: Mit KI gegen Borkenkäfer
Der Borkenkäfer sorgt in ganz Mitteleuropa für große Schäden in den Wäldern. Ein Interreg-Projekt in Österreich und Tschechien will nun Künstliche Intelligenz nutzen, um gegen den Schädling vorzugehen.
In Mitteleuropa haben steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster zu extremer Dürre geführt. Das belastet die Wälder. Gleichzeitig begünstigten diese Bedingungen die Vermehrung des Borkenkäfers (Ips typographus). Ein massives Waldsterben in Österreich und Tschechien ist die Folge. „Die heimische Holzwirtschaft steht durch den vermehrten Borkenkäferbefall vor großen Herausforderungen. Mit innovativen Ansätzen wollen wir die Gesundheit unserer Wälder langfristig sichern“, sagt Klara Stadler, Projektmanagerin im Building Innovation Cluster der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria.
Bekannte Methoden stoßen an Grenzen
Die aktuelle Lösung basiert auf dem rechtzeitigen Suchen und Entfernen befallener Bäume. Weitere Methoden – beispielsweise der Einsatz von Pestiziden oder Fangfallen – gelten als Ergänzung oder Überwachung der Situation, sind unter den neuen Bedingungen allerdings nicht wirksam genug. Ein Grund dafür ist die mangelnde Weiterentwicklung von Pheromonen. Seit Jahrzenten wird derselbe Lockstoff „Pheroprax A“ verwendet.
Mit KI gegen das Waldsterben
Das Projektteam von SMARTbeetle (Smell-based Molecular Artificial Intelligence to Fight Bark Beetle) will mit modernen biologischen Methoden und künstlicher Intelligenz optimierte Pheromonmischungen entwickeln, um die Effektivität von Fallen zu steigern und Nichtzielarten zu schonen. Dadurch soll nicht nur die Waldsterberate reduziert, sondern auch auch der Einsatz von Pestiziden verringert werden.
„Künstliche Intelligenz beschleunigt die Entwicklung von Pheromonfallen, indem sie dabei hilft, vorherzusagen, welche Duftstoffe gut an die Geruchsrezeptoren von Insekten binden. So können aus einer großen Zahl möglicher Substanzen gezielt die vielversprechendsten ausgewählt und anschließend im Labor oder im Feld getestet werden. Das spart Zeit und Aufwand und erhöht die Chance, besonders wirksame Lockstoffe zu finden.“, erklärt Manuela Geiß vom Software Competence Center Hagenberg (SCCH).
Sieben Partner, vier Jahre
Insgesamt besteht das Konsortium – angeführt vom Software Competence Center Hagenberg – aus sieben Partnern in Österreich und Tschechien. „Die grenzüberschreitende Kooperation zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen fördert auch den Dialog zwischen Behörden und Waldbesitzern beider Länder. Der Austausch von Daten und Erfahrungen verbessert die Überwachung der Borkenkäferpopulationen und ermöglicht frühzeitige Gegenmaßnahmen“, ist Simona Standler, Projektmanagerin im Softwarepark Hagenberg, überzeugt. Die Projektlaufzeit von vier Jahren gewährleiste ausreichend Zeit für die Validierung der Lockstoffe in der Praxis.