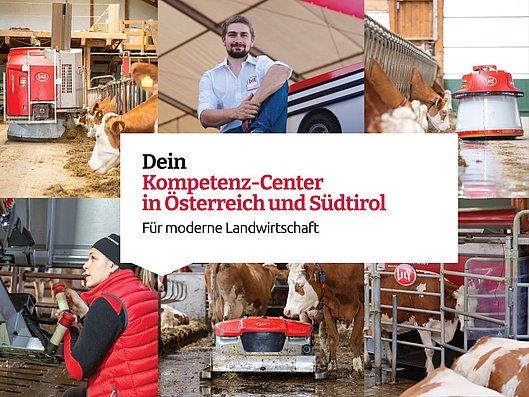Gezielte Forschung für Bergbauern
Eine Standortbestimmung war die Vorstellung der Ergebnisse des Aktionsplans Berglandwirtschaft. Sie machte deutlich, wie gut vernetzt die Forschung für die heimische (Berg-)Landwirtschaft ist. Und wie wichtig. Denn mehrfach wurde gebeten, weiter in diese Bereiche zu investieren.
„In schwierigen Zeiten muss man mit hoher Qualität, mit neuen Kulturen und Verfahren sowie mit garantierter Herkunft punkten“, unterstrich Angelo Zanella vom Versuchszentrum Laimburg die Überlegungen, die die Südtiroler Landesregierung im Jahr 2015 dazu bewogen haben, den Aktionsplan Berglandwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften ins Leben zu rufen. Dafür wurden im Jahr 2015 Geldmittel zur Verfügung gestellt, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch technische Gerätschaften finanzieren zu können. Kürzlich wurden die wichtigsten Ergebnisse der Forschungsarbeiten, die in den letzten Jahren geplant und umgesetzt wurden, vorgestellt: Forscherinnen und Forscher des Versuchszentrums Laimburg sowie der Freien Universität Bozen präsentierten am NOI Techpark einige Ergebnisse aus dem umfangreichen Programm, das zum Ziel hat, Bergbäuerinnen und -bauern neue Möglichkeiten aufzuzeigen, um ihren Betrieben die Zukunft zu sichern: Die Projekte und Versuche reichen von diversen neuen Nischenkulturen wie Minikiwi, Artischocke oder Speisehafer über den Systemvergleich Milch bis hin zur Verarbeitung von fermentierten nicht-alkoholischen Getränken oder die Prüfung von Erd- und Himbeersorten für die Verarbeitung zu Aufstrichen.
Da auch Vertreterinnen und Vertreter der Stakeholder, sprich einzelner Verbände (Südtiroler Bauernbund, Sennereiverband, VIP, Bioland Südtirol) und von Beratungsorganisationen wie dem Beratungsring Berglandwirtschaft bei der Präsentation zu Wort kamen, wurde deutlich, für wie wertvoll die praxisorientierte Forschung am Versuchszentrum Laimburg und an der Freien Universität Bozen eingestuft wird. So lautete der einhellige Appell, den Aktionsplan weiterzuführen und weitere Geldmittel dafür bereitzustellen.
Systemvergleich Milch und Qualitätsfleisch
Matthias Gauly vom Bereich Nutztierhaltung an der Freien Universität Bozen stellte zunächst die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Systemvergleich Milch vor. „Low-Input-Systeme sind wettbewerbsfähig, wenn das Produkt ,hochwertig‘ vermarktet werden kann“, erklärte er mit Verweis auf Bioheumilch und die entsprechend deutlich höhere Wertschöpfung daraus. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Betriebe Weidehaltung betreiben können, die Milchhöfe Kapazitäten für die Abnahme der Bioheumilch haben und die Preisdifferenz zu konventioneller Milch bestehen bleibt.
Auch zum Thema Qualitätsfleisch wird an der Universität Bozen geforscht. So hat sich in entsprechenden Studien herausgestellt, dass die Nachfrage nach heimischem Fleisch vorhanden und die Zahlungsbereitschaft entsprechend hoch ist. Allerdings sei die Fleischqualität derzeit noch sehr heterogen, die Rentabilität der Fleischproduktion zu niedrig und es fehle eine zentrale Vermarktungsstruktur, meinte Gauly. Er stellte aber bereits in Aussicht, dass die Arbeiten zum Systemvergleich weitergeführt werden, der Aufbau der Fleischproduktion weiter unterstützt und ausgeweitet würde – beispielsweise auch auf kleine Wiederkäuer.
Versuche im Futterbau
Giovanni Peratoner, Leiter der Arbeitsgruppe Grünlandwirtschaft und Futterbau am Versuchszentrum Laimburg erklärte, dass in seiner Forschergruppe 15 Projekte und Tätigkeiten auf 28 Versuchsflächen vorangetrieben werden – teils auch in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen wie beim Systemvergleich Milch. Der Schwerpunkt der Versuche liege im Pustertal und im Vinschgau. Peratoner stellte unter anderem einen Versuch vor, der die Optimierung von Kleegrasmischungen zum Inhalt hat, zudem arbeitet man an WebGRAS, einer Online-Schätzung der potenziellen Futterqualität des ersten Aufwuchses, die künftig auch auf die weiteren Aufwüchse ausgeweitet werden soll. Gemeinsam mit der Fondazione E. Mach und der Europäischen Akademie Eurac wird zudem eine Versicherung gegen Dürre im Grünland entwickelt. Zudem sei gerade ein Projekt zur Weidehaltung gestartet, wie Peratoner erklärte.
150 Gemüsearten getestet
Die Arbeitsgruppe Freilandgemüsebau steht unter der Leitung von Markus Hauser. Die rund fünf Hektar Versuchsfläche in Eyrs werden in Zusammenarbeit mit der Landesdomäne verwaltet, durch den Aktionsplan Berglandwirtschaft konnten zusätzliche personelle Ressourcen finanziert werden, wodurch die Versuchstätigkeit ausgeweitet werden konnte: Die geprüften Arten und Sorten umfassen Gemüse von A wie Artischocke bis Z wie Zwiebel, in den Versuchen erarbeiten die Forscherinnen und Forscher wertvolle Informationen zu ihrer Anbaueignung, zu Anbautechnik und Kulturführung, zu Hilfs- und Pflegemaßnahmen.
So wurden in den letzten fünf Jahren 150 Gemüsearten und -sorten getestet und gleichzeitig 67.500 Kilogramm Gemüse geerntet und auch vermarktet. Dadurch finanziert sich das Versuchsfeld zu einem Drittel selbst.
Acker- und Kräuteranbau
Manuel Pramsohler, Leiter der Arbeitsgruppe Acker- und Kräuteranbau, stellte die aktuellen Versuche in den Bereichen Sortenprüfung (z. B. bei Braugerste) und Kulturführung (Dünge- und Saatdichte-Versuche) sowie zu Vermehrung und Erhaltungsanbau von Landsorten vor. Im Kräuteranbau geht es zusätzlich um die Prüfung der Sorten an verschiedenen Standorten und ihr Einfluss auf die Ausbildung der Inhaltsstoffe. So konnte bei einem Vergleich von Zitronenmelisse-Sorten auf zwei verschiedenen Meereshöhen (am Garchhof in Meran auf 600 Meter Meereshöhe und in Laurein auf 1100 Metern über dem Meer) festgestellt werden, dass der Gehalt an ätherischem Öl auch in Grenzlagen hoch ist, dass Kräuteranbau also auch in hohen Lagen eine mögliche Alternative darstellt.
Den ganzen Bericht finden Sie ab Freitag in der Ausgabe 8 des „Südtiroler Landwirt“ vom 28. April ab Seite 41, online auf „meinSBB“ oder in der „Südtiroler Landwirt“-App.