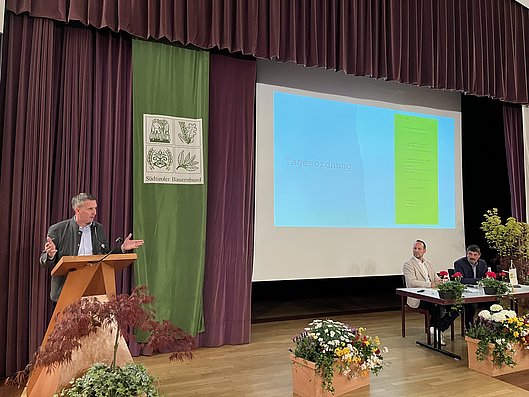Sind in einem Generationswechsel
Wieso sich die Weinwirtschaft von einer Männerdomäne langsam in eine gleichberechtigte Branche entwickelt, erklärt Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Wein. Er findet, dass einzig und allein Kompetenz zählen soll. Und dass sich Südtirol auch hier nicht zu verstecken braucht.
Südtirols Weinwirtschaft befindet sich in einem Generationswechsel, sagt Eduard Bernhart. Der Direkor des Konsortiums Südtirol Wein erklärt im Interview mit dem „Südtiroler Landwirt“ auch, dass Frauen immer schon eine wichtige Rolle innehatten, oft aber im Hintergrund geblieben sind. Mit der Übernehmergeneration ändert sich das jetzt.
Südtiroler Landwirt: Herr Bernhart, der Weinsektor scheint für Frauen zugänglicher zu sein als z. B. die Berglandwirtschaft und der Obstbau. Woran könnte das liegen?
Eduard Bernhart: Für mich ist es schwer, über andere Sektoren zu reden, weil mir da der Einblick fehlt. Ganz sicher ist es so, dass der Weinsektor in Südtirol über Jahre, ja Jahrhunderte traditionell eine Männerdomäne war. Allerdings darf man nicht den Fehler machen zu glauben, dass Frauen im Weinbau keine Rolle gespielt hätten. Im Gegenteil: Seit jeher haben Frauen in unseren Weinbergen wertvolle Arbeit geleistet, nur hat stets der Mann den Betrieb repräsentiert. Das ändert sich, seitdem in den 1970er-, 1980er-Jahren die ersten Frauen auch nach außen auftraten. Heute sind wir mitten in einem Generationenwechsel, denn es ist eine neue Generation an Frauen herangewachsen, die bereit ist, die Weinwelt zu erobern.
Welche nationale/internationale Weinbauregion könnte als Vorbild für soziale Nachhaltigkeit dienen?
Es mag sich vielleicht nach Lokalpatriotismus anhören, aber ich glaube nicht, dass wir in Südtirol in Sachen Gleichberechtigung hinter anderen Weinbauregionen hinterherhinken. Die jungen Frauen der Südtiroler Weinwelt ergreifen heute die Chance, neue Wege zu gehen und die Weinbranche zu revolutionieren. Sie setzen auf nachhaltigen Anbau, experimentieren mit alten und neuen Rebsorten und nutzen modernste Technologien, um das Beste aus den Weinbergen herauszuholen. Darüber hinaus leiten sie Weingüter, spielen in der Vermarktung eine große Rolle und repräsentieren unser Weinland nach außen. Dabei bewahren sie die Werte und das Erbe unserer Vorfahren, streben aber gleichzeitig nach Fortschritt und Innovation.
Was wäre Ihr Traum, wenn es um Frauenintegration geht?
Nennen wir es lieber Ziel als Traum. Schließlich arbeiten wir darauf hin, dass es auch in der Weinwirtschaft möglichst bald keine Rolle mehr spielt, welchem Geschlecht man angehört. Was zählen sollte, ist einzig und allein die Kompetenz. Und weil Frauen auch immer mehr eine gediegene Ausbildung im Weinbereich suchen, ist das nur eine Frage der Zeit. Davon bin ich überzeugt.
Man kann ja nicht behaupten, dass Frauen nicht vertreten wären, leider geraten sie aber meistens an die Rollen hinter den Kulissen: Marketing, Sekretariat ... Warum gibt es z. B. kaum Kellermeisterinnen?
Ich bin sicher, das ist die Außensicht. Wer ein wenig tiefer in unsere Branche schaut, merkt bald, dass es Frauen in allen Positionen gibt. Und es gibt durchaus auch Frauen, die im Keller das Sagen haben, nur noch keine in den großen Kellereigenossenschaften. Das ist allerdings eine Generationenfrage: Viele Kellermeister der Genossenschaften stammen noch aus einer Zeit, in der eine önologische Ausbildung für Frauen keine Option war. Heute ist das ganz anders.
Liegt das Problem auf beiden Seiten? Können Bring- und Holschuld eindeutig zugeordnet werden?
Ich denke, dass aus dem bis dato Ausgeführten hervorgeht, dass ich nicht von einem Problem sprechen würde. Was wir noch brauchen, ist ein wenig Zeit. Nur ein Beispiel: Eine der Ersten, die unsere neue Winzerlehre an der Fachschule Laimburg begonnen hat, war eine Frau. Auch das zeigt: Frauen treten verstärkt in die Weinbranche ein, die sich immer mehr in eine ausgewogene Richtung entwickelt.
Hätte die Weinagenda im Sinne der Gleichberechtigung klarer formuliert werden sollen?
Nein, das glaube ich nicht. Die Weinagenda zielt auf eine umfassende Nachhaltigkeit, also neben der ökologischen auch auf eine soziale. Die Gleichberechtigung ist ein Aspekt dieser sozialen Nachhaltigkeit, den wir schon heute fördern.
Welche Eigenschaften könnten Frauen verstärkt einbringen?
Es sollte in Beruf und Berufung keinen Unterschied ausmachen, ob man nun Mann oder Frau ist, denn das Wichtigste ist die Fach-,
Sach- und Sozialkompetenz. Erstere beide sind eine Frage der Aus- und Weiterbildung, Letzteres (auch) eine Frage der Persönlichkeit. Die Frage, ob es denn männliche und weibliche Weine gebe, haben wir übrigens auch einer Reihe von Winzerinnen gestellt und alle waren einhellig der Meinung: Es gibt nur gute und schlechte.