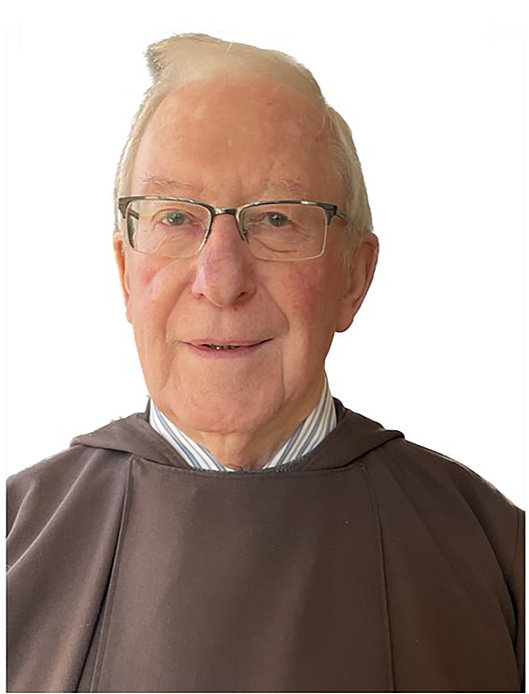Gottesgeburt im Seelengrund des Menschen
An Weihnachten feiern wir nicht nur die Geburt Christi, des Erlösers, sondern auch den Glauben an das Göttliche in uns selbst. Denn Christus wird in jedem von uns geboren: als Licht, das Dunkelheit vertreibt und Kälte. Das Heimat schenkt und Liebe, grenzenlose Liebe.
Da zur Zeit Jesu in Israel der Mondkalender galt, konnte kein jährlicher Geburtstag nach dem Sonnenkalender gefeiert werden. Im römischen Weltreich galt damals der Kalender nach der Reform von Julius Cäsar, der vor allem für die öffentliche Verwaltung das damals schon bekannte 365-Tage-Jahr nach dem Sonnenstand und den 1. Jänner als Neujahr bestimmte („Julianischer Kalender“). Kaiser Aurelian führte 274 n. Chr. zur Stärkung des römischen Sonnenkultes für den 25. Dezember das heidnische, antichristliche Fest des „Sol Invictus“ ein (unbesiegter Sonnengott).
„Sive Christi“, also des Christus
Als Kaiser Konstantin 311 n. Chr. durch das Mailänder Toleranzedikt das Christentum aus den Katakomben und von den Verfolgungen befreite, stand in einem Kalender neben dem Festtag des unbesiegten Sonnengottes mit anderer Handschrift die christliche Bemerkung: „(Dies natalis Solis Invicti) sive Christi“ – also des Christus!
So beschwor man den damaligen großen Umbruch im Römischen Reich mit dem Fest der Geburt Christi am 25. Dezember, während im Osten das Fest der Erscheinung Christi am 6. Jänner mit demselben ideologischen Hintergrund entstand. In wenigen Jahrzehnten wurden beide Feste miteinander vereint. So ergab sich jene weltweite Bedeutung des Glaubens an Jesus Christus, mit der heute praktisch in der ganzen Welt die Zeit vor und nach Christi Geburt benannt wird.
Freuen wir uns doch!
Papst Leo der Große brachte diese kraftvolle Bedeutung 150 Jahre später in einer Predigt auf den Punkt: „Während wir anbetend die Geburt unseres Erlösers Jesus Christus feiern, geschieht dies auch in der Feier unseres eigenes Anfanges (im christlichen Glauben). Unser Heiland ist heute geboren, freuen wir uns doch alle zusammen! Es ist kein Platz für die Traurigkeit am Tag, da das Leben geboren wurde, ein Leben, das die Angst vor dem Tod hinwegnimmt. Erkenne, o Christ, deine Würde! Da du der göttlichen Natur teilhaftig geworden bist, kehre nicht mehr durch eine unwürdige Lebensführung in die Zeit des Unglaubens zurück!“
Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werden kann
Neue Zeiten brechen immer mit kraftvollem Glauben und mit tief erlebten, gepflegten Liedern an. So haben neu bekehrte Völker viele der schönsten Texte unserer Liturgie verfasst und in junger Begeisterung gesungen. Augustinus z. B. ruft in einer Weihnachtspredigt seinen Christen in Nordafrika zu: „Unser Herr Jesus Christus, der Schöpfer aller Dinge, ist aus einer Mutter hervorgegangen als unser Retter und Heiland. Freiwillig ist er für uns in der Zeit geboren worden, um uns in die Ewigkeit des Vaters einzuführen.“ In Lehrbüchern der modernsten Kosmologen und Astrophysiker wird Augustinus genannt, der gespürt hat: Erst mit der Schöpfung (und insbesondere der Menschwerdung Gottes) sind als Urknall Zeit und Raum entstanden. Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werden kann.
Die Kirchenväter konnten noch verstehen, dass wir an Weihnachten unser eigenes Fest, das Fest der Erlösung, feiern. Die Geburt Christi betrifft uns, sie macht uns göttlich. Deshalb feiern wir an Weihnachten unseren Neuanfang. Was wir letztlich anstreben, ist die Vergöttlichung des Menschen. Wenn Gott selbst kommt, um uns göttlich zu machen, wird unsere Vorahnung wahr, dass es eine Liebe geben muss, die keine Grenzen kennt, dass es eine Heimat geben muss, in der wir uns für immer zu Hause fühlen können, dass schließlich das Licht die Dunkelheit und die Kälte vertreiben kann.
Welt, die sich durch Gottes Kommen verwandelt
An Weihnachten feiern wir die Geburt Christi in Bethlehem, damit wir glauben können, dass es göttliches Leben in uns gibt. Ohne diese Feier würden wir das Leben als das betrachten, was nach außen hin erscheint: unsere Arbeit, unsere Erfolge und Misserfolge, unsere menschlichen Beziehungen, Wertschätzung, Zuneigung, Liebe, unsere täglichen Freuden und Sorgen.
Wir brauchen viele Symbole, um gegen die Kraft der Tatsachen das Geheimnis zu glauben, dass Gott durch Christus in diese Welt gekommen ist. Wir schmücken Weihnachtsbäume, zünden Kerzen an, singen Weihnachtslieder, die das Geheimnis der Menschwerdung verkünden. In diesen vertrauten Bildern und Melodien sagen sie uns, dass die Welt durch Gottes Kommen verwandelt wird, dass wir uns in ihr ein wenig mehr zu Hause fühlen können.
Wir singen diese Hymnen, um in uns neue Möglichkeiten zuzulassen: Liebe, Zärtlichkeit, die Fähigkeit, zu staunen, sich einzulassen, zu fühlen. Wir singen vom göttlichen Kind in der Krippe, um in uns die zauberhaften Fähigkeiten eines Kindes zu entwickeln: Spontaneität und Echtheit, Lebendigkeit und Aufrichtigkeit, Reinheit und Unschuld. Der Dichter Angelus Silesius drückte dies in dem berühmten Satz aus: „Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du wärst für immer verloren.“
Das Geheimnis des Kindes in der Krippe geht auf uns über
Der Gedanke an die Geburt Gottes im Menschen durchdringt die Schriften der deutschen Mystiker im Mittelalter. Nach Johannes Tauler sind die Sorgen dieser Welt nichts anderes als die Geburtswehen für die Geburt Gottes in unserer Seele. Und für C. G. Jung ist die Geburt Gottes im Menschen das Ziel der menschlichen Selbstverwirklichung. Wenn Gott im Menschen geboren wird, befreit er sich von seinem kleinen Ich, um seine wahre Art und Weise, das Selbst, zu finden.
Im innersten Wesen der Seele, im kleinen Funken der Vernunft, findet die Geburt Gottes statt. In das Reinste, Edelste und Zarteste, was die Seele zu bieten hat, muss man eintreten. In dieser tiefen Stille erreichen uns weder Geschöpfe noch Bilder. Wir können etwas von diesem Geheimnis erahnen, wenn wir an Weihnachten in der Stille die Krippe betrachten. In uns ist Gott, so sanft und einfach wie dieses Kind in der Krippe. Wenn Gott in uns wie ein Kind wohnt, geht etwas von dem Geheimnis des Kindes auf uns über. Wir werden still, vorsichtig und zart.
Wir sind der Stall, in dem Gott geboren wurde
Wir dürfen die Geburt Gottes jedoch nicht so missverstehen, als könnten wir über ihn verfügen, wie wir wollen. C. G. Jung sagt, dass der Mensch immer daran denken muss, dass er nur der Stall ist, in dem Gott geboren wurde. Wir sind kein Palast, der bereit ist, Gott zu empfangen. Wir haben es nicht verdient, dass Gott in uns ist. Wir haben ihn nicht verdient, auch nicht durch Askese, Gebet oder Meditation. Wir bleiben nur der Stall.
In uns sehen wir oft Dunkelheit, Unordnung, Grenzen und Schwächen. Wir fühlen uns oft weit von Gott entfernt. Wir brauchen das Fest der Weihnacht, um daran glauben zu können, weil wir aus eigener Kraft dazu nicht in der Lage sind. Deshalb brauchen wir ein Fest, das uns zeigt, dass Gott in der Krippe, im Stall geboren wurde, zwischen Ochs und Esel. In der Herberge gab es keinen Platz für ihn!
Wir brauchen die Lieder und die Kerzen, um glauben zu können, dass die Geburt Gottes neue Akkorde in uns zum Klingen bringen kann. Vom Kind in der Krippe gilt das Lied: „Stille Nacht, heilige Nacht. Holder Knabe im lockigen Haar. Gottes Sohn, o wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund. Christ der Retter ist da.“